Rezension von Ramon
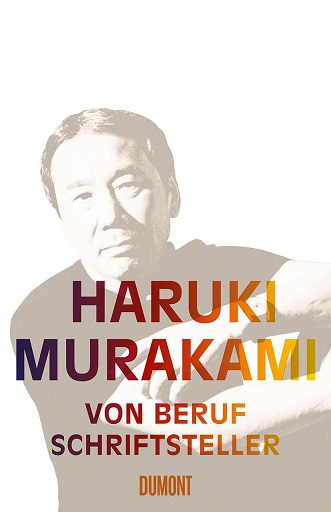 Von Beruf Schriftsteller ist – anders, als man vielleicht angesichts des Titels erwarten würde – keine Autobiografie Haruki Murakamis. Ebensowenig handelt es sich um einen Schreibratgeber, trotz Kapitelüberschriften wie „Und worüber soll ich schreiben?“ oder „Wie schreibe ich einen umfangreichen Roman?“
Von Beruf Schriftsteller ist – anders, als man vielleicht angesichts des Titels erwarten würde – keine Autobiografie Haruki Murakamis. Ebensowenig handelt es sich um einen Schreibratgeber, trotz Kapitelüberschriften wie „Und worüber soll ich schreiben?“ oder „Wie schreibe ich einen umfangreichen Roman?“
Eine Autobiografie ist das Buch insofern nicht, als dass Murakami auf Privates nur dann zu sprechen kommt, wenn es unmittelbar mit seiner schriftstellerischen Entwicklung in Zusammenhang steht. Und ein Ratgeber ist es nicht, weil es sich um sehr persönliche Texte handelt, in denen Murakami seine schriftstellerische Entwicklung und sein Verhältnis zur japanischen Gesellschaft und Literaturszene reflektiert.
Beispielsweise erfahren wir, wie der Autor zu seinem unverwechselbaren klaren und einfachen Stil gefunden hat. Mit Ende zwanzig setzte er sich an den Küchentisch und begann von Hand seinen ersten Roman zu schreiben. Mit dem Ergebnis unzufrieden, beschloss er, den Romananfang neu zu schreiben, diesmal aber auf einer Schreibmaschine mit englischer Tastatur. Da er die englische Sprache zu diesem Zeitpunkt eher mittelmäßig beherrschte, gerieten seine Sätze entsprechend kurz und waren mit einem begrenzten Wortschatz formuliert. So musste er lernen, kompliziertere Gedanken und Gefühle möglichst kompakt auszudrücken, ohne dass sie deswegen ihre Wirkung verfehlten. Nachdem er auf diesem Weg einen eigenen Stil gefunden hatte, schrieb er den Roman wieder ins Japanische um.
Außerdem erfahren wir, warum Murakamis Stil sich von der japanischen Gegenwartsliteratur so stark abhebt – er habe kaum moderne japanische Literatur gelesen, sondern „so gut wie alle russischen Romane des 19. Jahrhunderts und massenweise amerikanische Taschenbücher“. Denkt man gerade an seine frühen Werke wie Wilde Schafsjagd, so verbinden diese tatsächlich hard-boiled-Krimi-Motive amerikanischer Prägung mit der Exzentrik und der Ambivalenz der (magisch-)realistischen russischen Literatur.
Mit milder Ironie konstatiert Murakami, Schriftsteller seien in der Regel keine scharfsinnigen Menschen, da das Romane schreiben in einem gemächlichen Tempo vor sich gehe und sehr umständlich sei. Literaturkritiker hätten dadurch Schwierigkeiten, manche Romane überhaupt zu verstehen: „(…) sie sind, verglichen mit dem betreffenden Autor, zu klug, und ihr Verstand arbeitet zu schnell. Und mitunter kann jemand aufgrund dieser Veranlagung sein Tempo einem langsameren Gefährt nicht anpassen.“
In weiteren Essays stellt Murakami die gerade zu Beginn seiner Karriere deutliche Ablehnung der japanischen Literaturkritik in einen Zusammenhang mit der japanischen Kultur insgesamt, der er einen Zwang zur Konformität und Feindseligkeit gegenüber Neuerungen vorwirft. Er beschreibt, wie er in den 70er Jahren die Studentenbewegung in Japan wahrgenommen hat und schildert seine Beweggründe, warum er Japan später den Rücken kehrte. Nicht immer sind seine Reflexionen nur selbstbezogen. In einem Essay übt er Kritik am japanischen Schulsystem und dem staatlichen Versagen nach der Reaktorkatastrophe von Fukushima und findet hier für ihn ungewöhnlich scharfe Worte.
Auch wenn er einräumt, dass die Fähigkeit zu denken im Alter nachlasse, beschreibt Murakami seine schriftstellerische Laufbahn als kontinuierliche künstlerische Weiterentwicklung. Gerade die Verabschiedung von den namenlosen Ich-Erzählern der frühen Werke erscheint ihm als große Verbesserung. Hier werden ihm sicher nicht alle folgen können, sind doch gerade die früheren Werke nach Einschätzung der meisten Leser Murakamis Meisterstücke, wie sich in den einschlägigen Bewertungsportalen leicht überprüfen lässt. Auch ich bin der Auffassung, dass die in den 80er Jahren geschriebenen Romane Wilde Schafsjagd und Hard-boiled wonderland oder das Ende der Welt den (bisherigen) Höhepunkt von Murakamis Schaffen markieren. Dass die internationale Literaturkritik Murakami mit jedem neuen Roman mehr feiert, liegt ironischerweise vielleicht genau an der von ihm kritisierten Schwerfälligkeit der Kritiker gegenüber Neuerungen. So dauert die Akzeptanz eines Autors wie Murakami, der mit seinem Stil die Konventionen der Hochliteratur unterläuft, so lange, bis dieser schon einen Teil seiner Innovationskraft eingebüßt hat und sich zu wiederholen beginnt.
Fazit
Das Buch ist vor allem für Kenner des Murakami’schen Werkes eine lohnenswerte Lektüre, die sich dafür interessieren, wie der Autor zu seinem Stil und seinen Themen gefunden hat und welche Haltung er in bestimmten gesellschaftlichen und künstlerischen Fragen einnimmt. Nebenbei erfährt man auch noch ein paar erstaunliche Dinge über die japanische Kultur. Beispielsweise, dass in Buchhandlungen Autorinnen und Autoren in getrennten Regalen geführt werden.
Info
Einer der elf Essays, „Wie ich Schriftsteller wurde“, erschien zuvor schon als Vorwort in Wenn der Wind singt/Pinball 1973.
Daten
Originaltitel: Shokugyo toshite no shosetsuka
Verlag: DuMont
Erscheinungsjahr: 2016
Übersetzung: Ursula Gräfe
233 Seiten
