Rezension von Ramon
In „Freiheiten“ versammelt die Schriftstellerin Zadie Smith ihre über die letzten Jahre geschriebenen Essays. Diese befassen sich sowohl mit politischen Themen als auch mit der bildenden Kunst, mit Literatur und verschiedenen gesellschaftlichen Phänomenen. Ihr Zugang ist dabei stets ein ganz persönlicher. Wie sie in ihrem Vorwort betont, ist sie ja eben keine Soziologin, Politikwissenschaftlerin oder Journalistin. Ihre Essays würden daher nur „von der affektiven Erfahrung eines einzelnen Menschen handeln“. Natürlich wird diese „affektive Erfahrung“ stets von einer kritischen (Selbst-)Reflexion und Analyse begleitet. Gerade dieses Zusammenspiel macht die Essays so lesenswert.
Wir erfahren unter anderem, wie sich Smith‘ Vorstellung davon, „was eine Persönlichkeit ist oder sein sollte“ von jener Mark Zuckerbergs unterscheidet, warum sie noch SMS in voll ausformulierten Sätzen schreibt, was sie den Rapper Jay-Z bei einem persönlichen Treffen gefragt hat, warum sie trotz früherer Aversion zu einem Fan von Joni Mitchell wurde oder welchen Zusammenhang sie zwischen Schreiben und Tanzen sieht. Viele Texte sind sehr leichtfüssig geschrieben. Einige wenige Essays, insbesondere jene zur Kunstbetrachtung, sind dagegen voraussetzungsreicher, weil sie sich auf Namen und Diskussionen beziehen, die nicht jedem ein Begriff sind.
Besonders spannend fand ich die politischen Essays. An den jüngeren Linken kritisiert Smith deren „eigentümliche Neigung“, abweichende Meinungen „zu zensieren oder zum Schweigen zu bringen: durch Plattformentzug, geschützte Räume und dergleichen mehr“. Das hält sie für einen grundlegenden Fehler. Immer wieder spricht sie sich dafür aus, die eigene Verletzbarkeit zuzulassen, sich den Dingen zu stellen. Das betrifft nicht nur unliebsame Äußerungen anderer, sondern auch die Schönheit der Dinge. Auch um diese wahrnehmen zu können, müsse man den eigenen Schutzraum verlassen.
Als größte Verlierer der sozialen Spaltung in Großbritannien bezeichnet Smith die weiße Arbeiterschicht. Diese habe nicht einmal mehr „die vermeintliche moralische Überlegenheit, die sich aus einem zugestandenen Trauma oder einem anerkannten Opferstatus ergibt“. Sie fragt sich angesichts des Brexit, warum eigentlich alle betonen, die Arbeiterschicht würde sich mit ihrem Abstimmungsverhalten „selbst eins reinwürgen“. Warum erwarte man angesichts ihrer Lage, dass sie sich als die „besseren Menschen“ erweisen? Vor diesem Hintergrund warnt sie auch vor einem zweiten Referendum, das die Politikverdrossenheit nur verstärken würde. Wichtiger sei es, Großbritanniens „Direktorium“ auszutauschen, so wie man es auch bei einer Brennpunktschule machen würde.
Smith ist eine leidenschaftliche Verteidigerin der liberalen Demokratie und glaubt an die Politik der kleinen Schritte, die sukzessive Fortschritte erzielt. Für die vielen Menschen mit „apokalyptischer Perspektive“ sei der Fortschritt vielleicht zu klein, sie selbst könne diese Sicht aber schon aus biografischen Gründen nicht teilen. Noch in den 1950er Jahren habe sie als schwarze Frau etwa weder wählen noch „aus dem gleichen Brunnen wie ihre Mitbürger trinken“ können, auch wäre ihr vorgeschrieben worden, in welchen Vierteln sie sich aufhalten und wen sie heiraten dürfe. Opferhaltungen sind Smith fremd. Ohne Diskriminierungen schönzureden, setzt sie sich immer wieder kritisch mit bestimmten Auswüchsen der Identitätspolitik auseinander.
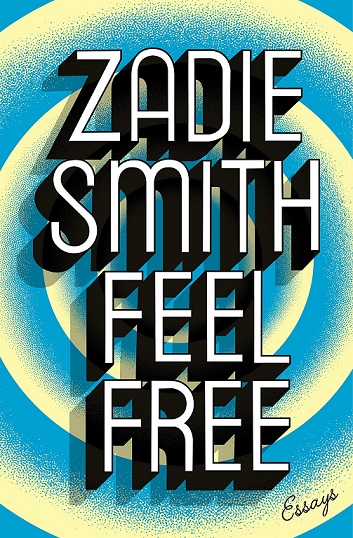
„Smith ist eine leidenschaftliche Verteidigerin der liberalen Demokratie und glaubt an die Politik der kleinen Schritte“
„Ich bin vom Wesen her kein politischer Mensch“, schreibt sie in einem Text. „Mein Gebiet, wenn man das so sagen kann, ist das private Leben der Menschen.“ Die titelgebenden „Freiheiten“ sind das verbindende Element der Essays. Immer wieder kreist Smith um die Frage, worin diese Freiheiten bestehen und wie man sie bewahren kann. Dabei versucht sie sich stets in verschiedene Menschen, Klassen und Milieus einzufühlen und argumentiert nie aus einer starren ideologischen Sicht heraus. Ihre Gedanken sind mitunter ambivalent. Nicht für alles findet sie eine befriedigende Lösung. Diese Offenheit hat mir gefallen. Als Leser der Essays fühlt man sich nicht gegängelt, sondern vielmehr zu eigenem Nachdenken ermutigt. Smith ist keine Rechthaberin. Sie will den Leser nicht bekehren, sondern ihre Gedanken teilen. Im Vorwort ermutigt sie ihre Leser selbst, die Essays je nach Bedarf „zu verändern“. So wird man auch Freude an dem Buch haben können, wenn man manche Ansichten der Autorin nicht teilt.
